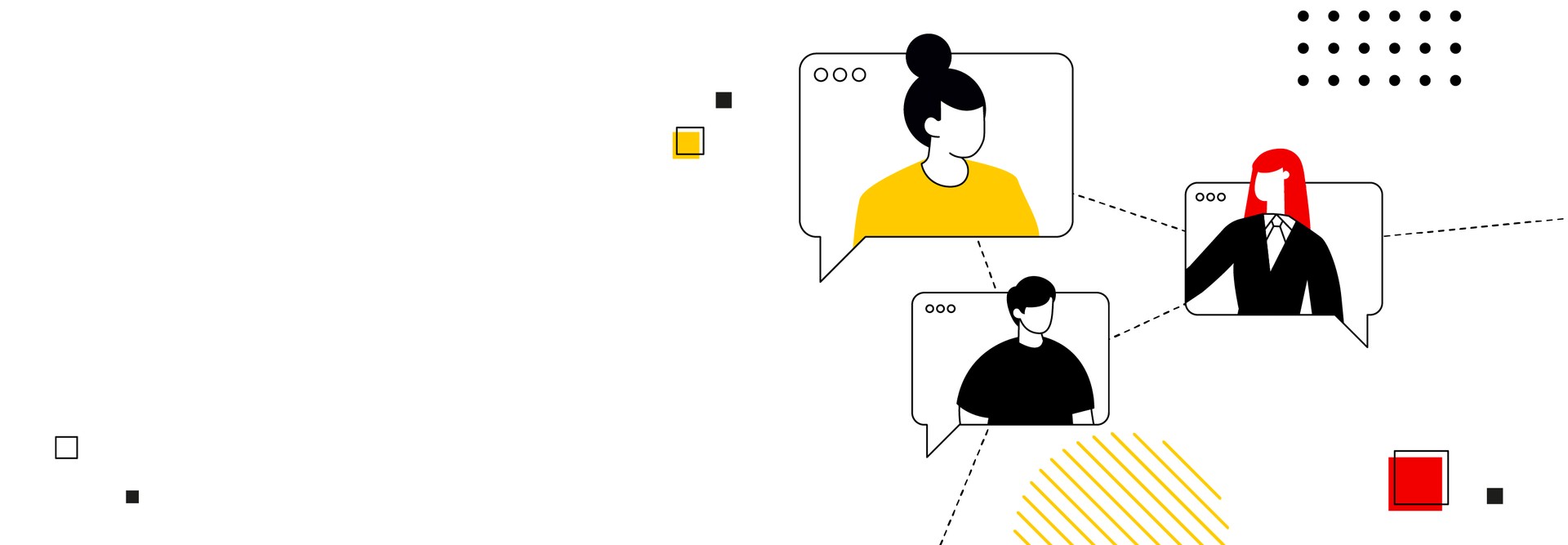Intro
Neuer Arbeitsmodus, bewährte Expertise: Auch 2024 wird ein Beirat die Umsetzung der Digitalstrategie Deutschland begleiten. Zusammen mit dem DigitalService ist ein neues Arbeitskonzept entstanden. Der Fokus liegt nun auf verstärkter Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Leuchtturmprojekten.
Wie geht es 2024 weiter, was ist neu?
Im Jahr 2023 hat sich der Beirat mit allen
Mit dieser Weiterentwicklung der Arbeitsweise werden zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen des Beirats aus seiner bisherigen Arbeit umgesetzt.

Beiratsmitglieder, DigitalService und BMDV gemeinsam: Nach einem intensiven Auftakttreffen im Februar 2024 begann die Umsetzung des neuen Arbeitsprogramms.
Was ist das Ziel?
Zentrales Ziel für 2024: Die Leuchtturmprojekt-Verantwortlichen in den zuständigen Bundesministerien und -behörden sollen sich noch intensiver zu gemeinsamen Themen und übergreifenden Herausforderungen austauschen. Dabei sollen sie voneinander lernen und Ideen für die optimale Umsetzung ihrer Vorhaben gewinnen. Die gesammelten Erkenntnisse werden Ende 2024 in „Lessons Learned“ für Öffentlichkeit und Politik zusammengefasst, damit sie bei der künftigen Ausgestaltung der Digitalpolitik berücksichtigt werden können.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die 19 Leuchtturmprojekte der Digitalstrategie werden fünf Clustern mit den folgenden Themen zugeordnet:
Nutzerzentrierung digitaler Angebote & Services
Umsetzungsformen & Verstetigung von befristeten Projekten
Projekte mit Datenfokus / Datenräume
Ebenen- & ressortübergreifende Zusammenarbeit
Wirkungsorientierung
Die Cluster sind Arbeitsgruppen, die Vertrauensräume bilden. In ihnen kommen die Projektverantwortlichen untereinander ins Gespräch sowie mit Expertinnen und Experten aus dem Beirat, dem DigitalService und der Agora Digitale Transformation. Die Lernreise eines jeden Clusters besteht aus zwei Cluster-Treffen, bei denen die Beteiligten Wissen und Erfahrungen zu dem jeweiligen Cluster-Thema teilen und voneinander lernen.
Das erste Cluster-Treffen ist der Auftakt der gemeinsamen Lernreise und dient dazu, konkrete Themen zu finden, die im zweiten Cluster-Treffen, dem sogenannten Deep Dive, vertieft behandelt werden. Zusätzlich finden zwei Netzwerktreffen statt, die den Erfahrungsaustausch und das Teilen von Best Practices über die Grenzen der Cluster hinweg ermöglichen sollen.
Was sind die wichtigen nächsten Schritte?
Zwei der fünf Cluster starteten im März 2024: Nutzerzentrierung digitaler Angebote & Services sowie Umsetzungsformen & Verstetigung von befristeten Projekten. Die weiteren Cluster folgen im Juni. Am 04.07.2024 und am 01.10.2024 finden die Netzwerktreffen statt.
Darüber hinaus gibt es regelmäßige Arbeitssitzungen vom Beirat Digitalstrategie mit dem DigitalService, der Agora Digitale Transformation und dem BMDV, um die Fortschritte und Optimierungsbedarfe des neuen Arbeitsprogramms zu diskutieren. Nach dem Auftakttreffen am 02.02.2024 finden noch vier gemeinsame Arbeitssitzungen statt, zwei im ersten halben Jahr und zwei im zweiten.
Wie ist die Arbeit in Clustern angelaufen?
Zwei Cluster lernten sich im März in Workshops persönlich kennen und schufen sich einen vertraulichen Gesprächsraum. Die Leuchtturm-Projektverantwortlichen stellten ihre Projekt-Steckbriefe vor und legten den Grundstein für einen vertieften inhaltlichen Austausch. Fast alle Beteiligten bewerteten die Treffen als Vertrauensraum, in dem sie sich offen und konstruktiv mitteilen können. Auf dieser Basis haben die Leuchtturmprojekt-Verantwortlichen und die Expertinnen und Experten aus dem Beirat und dem DigitalService thematische Fragestellungen besprochen und daraus konkrete Themen für das zweite Cluster-Treffen, den Deep Dive, gemeinschaftlich festgelegt.
In der darauffolgenden koordinierenden Arbeitssitzung von Beirat, BMDV, Agora Digitale Transformation und DigitalService waren die Erfahrungen und ersten Erkenntnisse aus den ersten Cluster-Treffen ein zentrales Thema. Die Teilnehmenden der Sitzung nahmen die Methodik unter die Lupe und sprachen über organisatorische Anpassungen, inhaltliche Tipps und Impulse für den weiteren Austausch in den Clustern. Sie bewerteten sehr positiv, dass die Mehrheit der Beteiligten der Cluster diese als Vertrauensräume empfunden hat. Zum Programm der zweiten Cluster-Treffen wurde darüber hinaus noch diskutiert, etwa zur Frage: Welche Rechtsformen und Arten der Finanzierung kämen in Frage für die Verstetigung von befristeten Projekten?